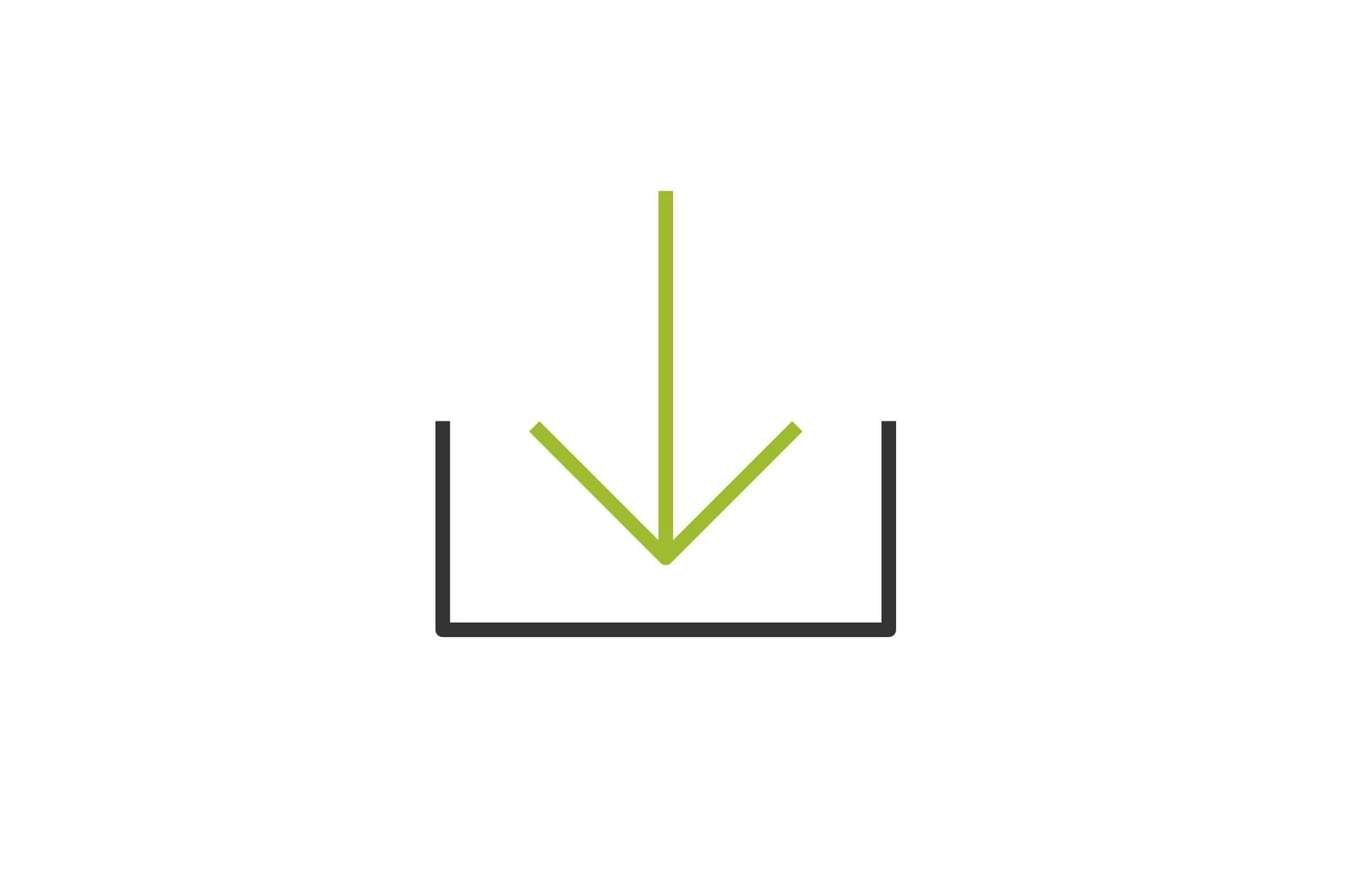Game of Zones II: Physik vs. Bilanz – Wie kommt das zusammen?
Die Regelzonen sind wie sie sind – aber macht das auch Sinn? In diesem Blogbeitrag überlegen wir, ob eine aus technischer und wirtschaftlicher Sicht effizientere Aufteilung denkbar ist und räumen dabei mit ein paar häufigen Missverständnissen um den Strommarkt auf.

Im ersten Blogbeitrag der Serie haben wir darüber gesprochen, dass sich unsere vier Regelzonen aus der föderalen Tradition Deutschlands entwickelt haben: Ursprünglich waren die Stromversorger Monopolisten und in ihren Gebieten neben der Versorgung auch für den Netzbetrieb zuständig. Im Zuge der Strommarktliberalisierung sind nach und nach die heutigen vier Regelzonen entstanden, deren Betrieb von der Stromversorgung mittlerweile organisatorisch entkoppelt ist. Doch selbst mit (nur) vier Regelzonen ist Deutschland noch ein Sonderfall: Das zentralistische Frankreich ist zwar fast doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur einen Übertragungsnetzbetreiber. Ebenso steht es mit den Niederlanden, Belgien, Österreich, Dänemark und vielen weiteren europäischen Ländern. Darum stellt sich uns die Frage: Ist diese Aufteilung des deutschen Übertragungsnetzes, die auf geopolitische Gegebenheiten zurückzuführen ist, sinnvoll? Oder wäre eine nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten effizientere Aufteilung denkbar?
Eine technische Herangehensweise
Aus technischer Sicht kann man die Sache relativ einfach angehen, indem man die bestehenden Netze und Kuppelstellen zwischen den Regelzonen als gegeben annimmt. Die Konsequenz: Der Strom fließt ohnehin innerhalb der bestehenden Netzkapazitäten – unabhängig davon, wer der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist, durch dessen Netz er gerade fließt. Aus dieser Perspektive ist es also zunächst einmal irrelevant, wie viele ÜNB es gibt. Da interessiert nur die bestehende und zukünftige Infrastruktur. Dabei sind zwei Grundsätze besonders zu beachten:
- 1. Stromnetze speichern keinen Strom. Wenn Strom einmal von einem Kraftwerk aus unterwegs ist, dann muss er von irgendeinem Verbraucher entnommen werden. Das schließt auch Übertragungsverluste, Eigenverbrauch von Kraftwerken und Zwischenspeicher ein, die in diesem Zusammenhang auch als „Verbraucher“ verstanden werden. Wird der Strom nicht verbraucht, sucht er sich gewaltsam ein Ventil, was erhebliche Schäden verursachen kann, je nachdem wie viel überschüssige Energie aus dem Netz drängt.
- 2. Die Netzfrequenz ist überall (ungefähr) gleich. Sie muss zwischen 49,8 und 50,2 Hertz liegen, damit das Stromnetz stabil ist. Der Strom fließt annähernd mit Lichtgeschwindigkeit durch das Stromnetz, das heißt solange die Netzkapazitäten ausreichen, ist es tatsächlich egal, ob Strom im Norden eingespeist und erst im Süden verbraucht wird – Übertragungsverluste einmal außer Acht gelassen. Der Strom kann (und muss!) also selbst über lange Distanzen zur gleichen Zeit verbraucht werden, zu der er auch produziert wurde.
Gleichzeitig können mehrere ÜNB technisch für mehr Netzsicherheit sorgen: Wenn ein Stromausfall in einer Regelzone geschieht, den ein einzelner ÜNB nicht auf Anhieb beheben kann, können die übrigen ÜNB den regelzonenübergreifenden Austausch einschränken und ihre Regelzonen weitgehend selbstständig steuern. Im besten Fall bedeutet das: Wenn um Berlin einzelne Kraftwerke oder Netzabschnitte ausfallen, geht deswegen nicht auch in Hannover, Köln, Stuttgart und München das Licht aus. Das Gesamtnetz wäre also nicht gleich mitgefährdet.
Eine wirtschaftliche Herangehensweise
Aus wirtschaftlicher Sicht haben wir vier ÜNB, die innerhalb geographischer Grenzen ein Netz verwalten, das niemand von ihnen (in der heutigen Gesellschaftsstruktur) gebaut hat. Niemand von ihnen hat festgelegt, dass das Netz so aussehen soll, wie es aussieht. So betrachtet, führt eine größere Zahl von ÜNB erst mal zu höheren Managementkosten, weil die Stromhändler im Markt nicht nur einen einzigen Bilanzkreis für ganz Deutschland verwalten müssen, sondern einen pro Regelzone. Und sie müssen sicherstellen, dass diese vier Bilanzkreise immer ausgeglichen sind. Und das müssen sie bei vier ÜNB melden anstatt bei einem. Das Ganze nennt sich Fahrplanmanagement. Und das wäre in der Theorie um den Faktor 4 simpler, wenn es nur einen ÜNB gäbe. Hierzu möchten wir auch zwei wichtige Grundsätze definieren:
- 3. Bilanzkreise sind rein buchhalterische Hilfsmittel, die Ordnung in den Strommarkt bringen. Sie zeigen wer wie viel Strom kauft und verkauft – sie spiegeln aber nicht, wie der Strom physisch fließt. Ein Bilanzkreis ist ein Konto der Strommengen, die ein Unternehmen in das Stromnetz einspeist und aus dem Stromnetz entnimmt. Es schließt alle Käufe und Verkäufe von oder zu anderen Marktteilnehmern ein: Wenn der Saldo null ist, ist der Bilanzkreis glatt gestellt und es fällt keine Ausgleichsenergie an. Innerhalb einer Regelzone müssen die Unternehmen hierfür dem ÜNB zunächst im Vorhinein die Strommengen mitteilen, die sie in jeder Viertelstunde des Folgetages produzieren oder verbrauchen wollen. Diese Fahrpläne der Einspeisungen und Entnahmen werden später mit den tatsächlichen Werten verrechnet. Abweichungen vom Fahrplan, d.h. über- oder unterproduzierte Mengen, werden vom ÜNB zunächst mit den über- und unterproduzierten Strommengen anderer Bilanzkreise verrechnet. Die darüber hinausgehenden Abweichungen werden mit Regelenergie ausgeglichen. Die Kosten hierfür, die Ausgleichsenergie, werden dem verantwortlichen Unternehmen in Rechnung gestellt – und stellen damit den Bilanzkreis glatt.
- 4. Der Stromhandel muss grundsätzlich getrennt vom Regelenergiemarkt betrachtet werden. Der Regelenergiemarkt wird von den ÜNB verwaltet. Sein Ziel ist die Netzstabilität zu allen Zeiten. Der Stromhandel findet auf anderen Märkten statt, zum Beispiel an den Strombörsen EEX und EPEX Spot. Die Bilanzkreise der Stromhändler müssen zwar auch regelzonenscharf ausgeglichen werden, allerdings passiert dies nicht physisch entlang der Grenzen der Regelzonen, sondern bilanziell über das Fahrplanmanagement der Händler. So können zum Beispiel Strommengen, die in der Regelzone von TenneT produziert wurden, in der Zone von 50Hertz verbraucht werden. Dies wird dann im Fahrplanmanagement berücksichtigt, um die einzelnen Bilanzkreise in allen Regelzonen genau glattzustellen.
Resümee
So viel erst einmal zu den Grundlagen. Als Zwischenergebnis können wir festhalten:
- Aus technischer Sicht ist die Anzahl der Regelzonen zunächst egal: Der Strom nimmt immer den kürzesten Weg von der Produktion zum Verbrauch – ganz egal, ob irgendwo eine Regelzone endet oder nicht. Mehrere ÜNB können aber für mehr Netzsicherheit sorgen, wenn sie beim Ausfall einzelner Netzbereiche ihre Regelzonen entkoppeln und damit einen Gesamtkollaps des Netzes verhindern.
- Aus wirtschaftlicher Sicht führen mehrere Regelzonen zunächst dazu, dass Marktteilnehmer mehrere Bilanzkreise führen müssen. Diese alle auf null zu halten bedeutet einen größeren Aufwand für das Fahrplanmanagement.
Das Sicherheitsargument aus der technischen Perspektive ist natürlich stark und würde sicherlich höhere Kosten für das Fahrplanmanagement rechtfertigen. Das aber auch nur, wenn es wirklich heutzutage noch möglich ist, die Regelzonen als Inselnetze zu betreiben. Wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit der ÜNB? Und wie eigenständig können die ÜNB tatsächlich agieren? Diese Fragen stellen wir uns in unserem nächsten Blogbeitrag der Serie.
Weitere interessante Links
- ein Überblick über das deutsche Strommarktdesign
- eine detailliertere Erklärung von Regelenergie
Fotocredit: James Webb Space Telescope, Lizenz: CC BY 2.0, zusätzliche Filter durch Next Kraftwerke angewandt
Weitere Informationen und Dienstleistungen